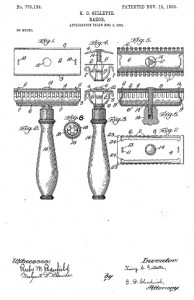Seien wir ehrlich: 95 Prozent der Boxkämpfe, mit denen wir derzeit am Samstag abend gequält werden, kann man knicken. Wer will denn zum xten Mal sehen, wie ein Klitschko auf irgendwelches Fallobst eindrischt? Oder wie irgendein namenloser Boxer aus dem Sauerland-Stall mal wieder seinen Hang zum Pazifismus entdeckt, wenn er ein Ringseil sieht? Muss wirklich nicht sein.
Seien wir ehrlich: 95 Prozent der Boxkämpfe, mit denen wir derzeit am Samstag abend gequält werden, kann man knicken. Wer will denn zum xten Mal sehen, wie ein Klitschko auf irgendwelches Fallobst eindrischt? Oder wie irgendein namenloser Boxer aus dem Sauerland-Stall mal wieder seinen Hang zum Pazifismus entdeckt, wenn er ein Ringseil sieht? Muss wirklich nicht sein.
Wenn Michael Buffer nervt, bleibt der Griff zur DVD. Einen gut gemachten Box-Film kann man immer anschauen. Hier sind meine Top Ten.
ausgezählt und nicht mehr in der Wertung:
Ali
Der Film über den größten Boxer aller Zeiten nicht mehr in den Top Ten? Leider ja. Trotz einer recht inspirierten Vorstellung von Will Smith: dieser Film gibt uns allenfalls eine Ahnung von dem einmaligen, federleichten Fighter, der Ali einmal war. Der Film geht über die volle Distanz (zwoeinhalb geschlagene Stunden) und ist entschieden hüftsteif, ganz im Gegensatz zu dem Mann, der wie ein Schmetterling tanzte und wie eine Biene stach.
Den wollte ich eigentlich nicht in den Top Ten haben, weil ich Denzel Washington für einen gnadenlosen Langeweiler halte, und dieser Streifen ist sowas von gut gemeint und politisch korrekt, es ist zum Kotzen! Dummerweise ergreift er einen aber auch, wenn man länger als eine Viertelstunde zuguckt, und Washington ist diesmal mehr tatsächlich mehr gut als langweilig. Ein Box-Film der eigentlich nicht gut sein sollte, es aber trotzdem ist. Als Kontrastprogramm zu einem überflüssigen Klitschko-Fight kann man sich den jederzeit reinziehen
Ein total idiotischer Plot (Junge, der tolle Geige spielen kann, kann auch toll boxen und muss sich entscheiden), ein kruder Genre-Mix (Coming-of-Age, Gangster, Boxen) und eine einigermaßen ungelenke Inszenierung… was will dieser Film in den Top-Ten? Nu ja, William Holden und Barbara Stanwyck reißen’s raus und haben das eigene Sub-Genre der Golden-Boy-Remakes (Junge, der irgendwas anderes besser kann, muss sein Geld mit Boxen verdienen) kreiert. Eins der Beispiele, wo der kopfschüttelnde Dramaturg widerlegt wird: ein Film, der gegen alle Regeln verstößt, und gerade deswegen Jahrzehnte überdauert.
„No one ever hit me harder than Rocky Graziano“, sagte Sugar Ray Robinson über den Mann, dessen Leben die Vorlage für diesen Film gab, und wir geben das Kompliment an den Mann weiter, der Graziano spielt, Quatsch, der uns Graziano mit süffisantem Grinsen in die Fresse haut: Paul Newman! Nobody hits us harder…
Und natürlich gewinnt dieser Film den Preis für den idiotischsten deutschen Titel. Der Typ, der von „Somebody up there likes me“ auf „Die Hölle ist in mir“ gekommen ist, muss 12 Runden gegen Tyson gegangen sein.
Stark beeindruckendes Bio-Pic über Boxlegende „Irish“ Micky Ward und seinen Weg vom „Sprungbrett“ (einem Boxer, den man auf dem Weg zur Titelverteidigung schlagen muss) zum Champion. Kaum zu glauben, dass der Film auf Tatsachen beruht. Kaum zu glauben, wie der Film die Wende vom düsteren Sozial-Drama zum Feelgood-Movie schafft. Kaum zu glauben, wie gut Christian Bale als cracksüchtiger Box-Trainer ist.
Okay, Frauenboxen. Selbstverständlich grenzwertig. Aber Hilary Swank hat einen gemeinen Punch drauf, she’s a contender. Und es ist ein Eastwood-Film. Es ist eine Schande, dass Eastwood nie selber einen Boxer gespielt hat (warum eigentlich nicht?), jetzt ist er zu alt, also ist „Million Dollar Baby“ das beste, was wir von diesem herausragenden Mann bekommen werden: den besten Box-Trainer-Film aller Zeiten. Der Schluss ist herzzerreißend.
Stallone häuft Klischee auf Klischee und Zitat auf Zitat, aber irgendwie ist es ihm gelungen, mit dem Underdog-Haudrauf Rocky Balboa einen Charakter zu schaffen, der größer ist als er selbst. Echte Box-Fans schließen angesichts der Ring-Szenen, die eher an Wirtshausprügeleien als an tatsächlichen Boxsport erinnern, entnervt die Augen, aber wer Rocky Balboa nicht mag, hat kein Kämpferherz in der Brust. Das 1:1-30-Jahre-später-Remake „Rocky Balboa“ von 2006 ist die Mutter aller „Alter-Sack-kann-es-noch“-Filme.
Passt als Doku eigentlich gar nicht in diese Aufzählung, aber da es um einen der faszinierendsten Fights aller Zeiten geht, und niemand Foreman und Ali so gut spielen kann wie Foreman und Ali selber (sorry, Will Smith) geht Rang 4 wohl in Ordnung. Hat so ein gewisses „Wunder von Bern“-Feeling: Obwohl man genau weiß, wie’s ausgeht, fiebert man mit und drückt Ali die Daumen. Rope-a-Dope!
Es ist unmöglich, ohne ein breites Grinsen auf dem Gesicht aus einem Errol-Flynn-Film herauszukommen, und aus diesem schon gar nicht. Die augenzwinkernd-sportive Eleganz, mit der Flynn James J. Corbett (oder besser gesagt, einen Typen, der entfernt etwas mit dem tatsächlichen Jim Corbett zu tun hat) spielt, ist unnachahmlich. Und Ward Bond als John L. Sullivan (der mit seinem historischen Vorbild genauso wenig zu tun hat) gibt einen wunderbaren Antagonisten der Snidley-Whiplash-Klasse ab. Ein Riesenspaß.
Knapp nach Punkten geschlagen: der zweitbeste Box-Film aller Zeiten mit dem besten Boxer-Darsteller aller Zeiten. Wie de Niro Jake la Motta spielt, ist schlichtweg atemberaubend, vor allen Dingen in den Szenen im Ring. Man sieht keinen Schauspieler, der einen Boxer spielt, man sieht einen vom Kampf besessenen Fighter, der alles gibt. Elektrisierend.
Ein steinalter Kirk-Douglas-Film, den keine Sau kennt, soll der beste Box-Film aller Zeiten sein? Doch, unbedingt. Die Art und Weise wie Douglas hier den begnadeten Stinkstiefel Midge Kelly gibt, ist schlichtweg weltmeisterlich, wie der ganze Film: schmissige Musik, kernige Dialoge, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder… der Film hat alles, was ein Fighter braucht: Technik, Stil, Punch, Power und Speed – so sieht der Weltmeister aller Klassen aus.
Foto: A. Dengs / pixelio.de



 Viele Jahre später, am 4. Februar 2008 beamte die NASA „Across the Universe“ ins Weltall. Der Song ist mit einer Geschwindigkeit von 186.000 Meilen pro Sekunde zu einem Stern namens Polaris unterwegs, 431 Lichtjahre von der Erde entfernt. Lennons Musik jagt durch die Lautlosigkeit des Weltalls, eine ähnlich schreckliche Lautlosigkeit wie die, die wir auch seit 30 Jahren ertragen müssen. Seit die Schüsse vor dem Dakota Building fielen.
Viele Jahre später, am 4. Februar 2008 beamte die NASA „Across the Universe“ ins Weltall. Der Song ist mit einer Geschwindigkeit von 186.000 Meilen pro Sekunde zu einem Stern namens Polaris unterwegs, 431 Lichtjahre von der Erde entfernt. Lennons Musik jagt durch die Lautlosigkeit des Weltalls, eine ähnlich schreckliche Lautlosigkeit wie die, die wir auch seit 30 Jahren ertragen müssen. Seit die Schüsse vor dem Dakota Building fielen.